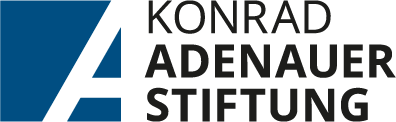Konflikte: Warum streiten?
Wie entstehen Konflikte? Was ist ein Konflikt? Was macht ein Konflikt mit uns Menschen? Was passiert im Konflikt?
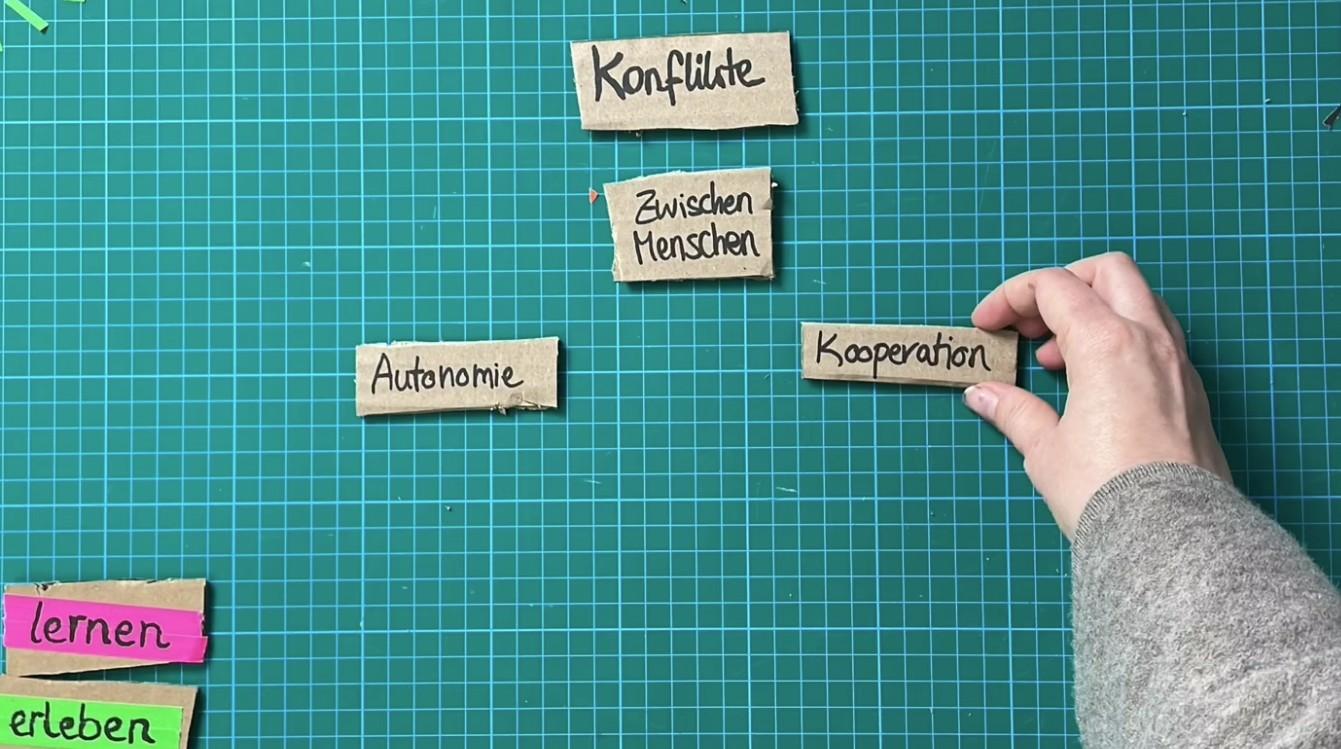
Wie entstehen Konflikte?
Kreatives Teambuilding mit Fokus auf Zusammenarbeit und Konfliktmanagement
Zielsetzung:
- Zusammenhalt stärken: Ihr lernt, wie wichtig Kommunikation und Vertrauen sind, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
- Konflikte erkennen und bewältigen: Durch bewusst eingebaute Herausforderungen erlebt Ihr, wie Spannungen entstehen und wie man sie lösen kann.
- Teamfähigkeiten entwickeln: Kreativität, Abstimmung, Respekt und Problemlösungsstrategien werden in einer praxisnahen, spielerischen Umgebung trainiert.
Ablauf
1. Einführung (10 Minuten):
- Wir starten mit einer kurzen Erklärung der Aktivität.
- Ziel: Ihr werdet gemeinsam mit Pinsel und Fäden ein einzigartiges Kunstwerk erschaffen.
2. Kreative Übung: "Pinsel-an-Fäden" (20min):
Variante A: Zusammenarbeit im Fokus
- Jeder von Euch hält ein Ende eines Fadens, der an einem Pinsel befestigt ist.
- Ihr malt gemeinsam ein Bild – aber nur, wenn ihr Euch gut abstimmt. Jede Bewegung zählt, und alle sind gefragt!
- Ziel: Harmonie und Kreativität in Einklang bringen.
Variante B: Konflikte bewusst erleben (20 min)
- Es wird spannend: Durch gezielte Herausforderungen schauen wir uns an, wie Ihr mit Konflikten umgeht:
- Unklare Ziele: Unterschiedliche Vorgaben sorgen für Zielkonflikte.
- Ungleiche Ressourcen: Mal gibt es nur kurze Fäden, mal unterschiedliche Farbzugänge.
- Zeitdruck: Eine knappe Deadline sorgt für Dynamik.
- Rollenzuweisung: Entscheider, Ausführende oder bewusst Ausgeschlossene bringen neue Dynamik ins Spiel.
- Bewusste Provokation: Ein Mitglied wird angewiesen, absichtlich gegen die Gruppe zu arbeiten.
3. Reflexion (20–30 Minuten):
Erlebnisanalyse:
- Was lief gut? Wo hakte es?
- Wie habt Ihr zusammengearbeitet oder Konflikte gelöst?
Konfliktreflexion:
- Wie habt Ihr Spannungen wahrgenommen?
- Welche Strategien waren hilfreich, um schwierige Situationen zu bewältigen?
Übertragung auf Euren Alltag:
- Was nehmt Ihr aus der Übung mit?
- Wie könnt Ihr diese Erkenntnisse in Eure tägliche Zusammenarbeit einbringen?
Besonderheiten der Übung:
- Förderung von Teamarbeit: Die Schüler*innen erleben unmittelbar, dass sie nur durch Kooperation ein gemeinsames Ergebnis erzielen können.
- Stärkung der Kommunikation: Um den Pinsel gezielt zu bewegen, müssen klare Absprachen getroffen und aufeinander Rücksicht genommen werden.
- Kreativitätsförderung: Die Übung bietet Raum für kreative Ausdrucksformen und macht sichtbar, wie unterschiedliche Ideen zu einem gemeinsamen Ergebnis verschmelzen können.
- Umgang mit Herausforderungen: Kleine Konflikte oder Missverständnisse entstehen bewusst und bieten die Möglichkeit, soziale Kompetenzen wie Empathie, Kompromissbereitschaft und Problemlösungsstrategien zu trainieren.
Einsatzmöglichkeiten in der Schule:
- Kennenlern- und Projekttage: Ideal, um neue Klassenkonstellationen zu stärken und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern.
- Sozialtraining: Zur Förderung sozialer Kompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation und Empathie.
- Kunstunterricht: Um kreative Prozesse mit Teamarbeit zu verbinden und neue Gestaltungsmethoden auszuprobieren.
- Demokratiepädagogik: Um demokratische Entscheidungsprozesse und den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen erlebbar zu machen.
- Konfliktlösung und Klassenklima: Als Einstieg in Gespräche über Konflikte, Teamstrukturen oder den Umgang mit Herausforderungen.
Die Übung eignet sich besonders für Gruppen von 4 bis 8 Personen und kann sowohl im Klassenzimmer als auch in der Aula oder im Freien durchgeführt werden. Sie erfordert wenig Material, bringt aber großen pädagogischen Mehrwert: Die Schüler*innen erleben, wie kreative Zusammenarbeit funktioniert – mit all ihren Herausforderungen und Erfolgen.
Übung: Bedürfnisse hinter gesellschaftlichen Konflikten
Jetzt bist du an der Reihe!
Diese Übung knüpft an das Deeper Learning aus dem zweiten Modul an und vertieft das Verständnis für die Dynamiken hinter gesellschaftlichen Konflikten.
Bedürfnisse hinter gesellschaftlichen Konflikten – Eine Methode zur vertieften Analyse
Ziel der Übung
Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass gesellschaftliche Konflikte aus dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Kooperation entstehen. Sie setzen sich in Konflikten für ihre eigenen Bedürfnisse ein, während erfolgreiche Lösungen meist durch zwischenmenschliche Kooperation entstehen. Diese Übung soll das Verständnis für verschiedene Perspektiven vertiefen und demokratische Entscheidungsprozesse begreifbar machen.
Methodische Verknüpfung mit Deeper Learning
Deeper Learning zielt darauf ab, kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen zu verbinden. Diese Methode fördert kritisches Denken, Reflexion, Kollaboration und die Fähigkeit zur Problemlösung. Indem die Schülerinnen und Schüler Bedürfnisse hinter gesellschaftlichen Konflikten analysieren, werden sie zu komplexem Denken angeregt und entwickeln ein tieferes Verständnis für demokratische Prozesse.
Ablauf der Übung
1. Vorbereitung
Eine Tabelle mit zwei Spalten auf einer Tafel, einem Whiteboard, großem Papier oder einem digitalen Medium
(z. B. iPad) vorbereiten
Spalte 1: „Gesellschaftliche Konflikte“; Spalte 2: „Dahinterliegende Bedürfnisse“
Die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen oder als ganze Klasse einteilen.
2. Themen sammeln
Die Schülerinnen und Schüler notieren in der ersten Spalte gesellschaftliche Konflikte, die ihnen einfallen.
Beispiele:
- Klimawandel
- Bildungspolitik
- Soziale Gerechtigkeit
- Migration
- Digitalisierung und Datenschutz
- Diversität und Gleichberechtigung
Die Gruppen diskutieren, welche Themen sie als besonders relevant erachten und begründen ihre Auswahl.
3. Analyse der Bedürfnisse
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die hinter den Konflikten liegenden Bedürfnisse.
Leitfragen zur Reflexion:
Welche Bedürfnisse haben Menschen, die sich für eine bestimmte Position einsetzen?
Warum könnte eine andere Gruppe eine gegensätzliche Position vertreten?
Welche universellen Bedürfnisse (z. B. Sicherheit, Gerechtigkeit, Freiheit) lassen sich identifizieren?
Beispiele:
Klimawandel: Bedürfnis nach Umweltschutz vs. Bedürfnis nach wirtschaftlicher Stabilität
Soziale Gerechtigkeit: Bedürfnis nach fairer Verteilung von Ressourcen vs. Bedürfnis nach individueller Leistungsanerkennung
Migration: Bedürfnis nach Sicherheit und Identität vs. Bedürfnis nach humanitärer Hilfe
4. Diskussion und Reflexion
Die Ergebnisse werden gemeinsam reflektiert und diskutiert:
Wie verändert das Verständnis der Bedürfnisse die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Konflikten?
Welche Rolle spielen Medien und Politik in der Wahrnehmung dieser Konflikte?
Welche Wege zur Konfliktlösung könnten gefunden werden?
5. Vertiefung durch kreative Methoden
Um das Verständnis weiter zu vertiefen, können folgende Methoden ergänzend eingesetzt werden:
Rollenspiele: Gruppen übernehmen unterschiedliche Perspektiven in einem Konflikt und debattieren eine Lösung.
Szenario-Analyse: Die Schülerinnen und Schüler entwerfen alternative Zukünfte basierend auf den Bedürfnissen der Beteiligten.
Mindmaps: Visualisierung der Zusammenhänge zwischen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Prozessen.
Projektarbeit: Entwicklung von Handlungskonzepten zur Konfliktbewältigung im lokalen oder schulischen Umfeld.
Fazit
Diese Methode fördert ein tieferes Verständnis für gesellschaftliche Konflikte, indem sie den Fokus auf die zugrunde liegenden Bedürfnisse richtet. Die Verknüpfung mit Deeper Learning ermöglicht nachhaltiges Lernen, indem Reflexion, Kollaboration und Problemlösungskompetenz gestärkt werden. Durch die Übung entwickeln die Schülerinnen und Schüler nicht nur ein verständnisvolleres Bild gesellschaftlicher Konflikte, sondern auch demokratische Handlungskompetenz.