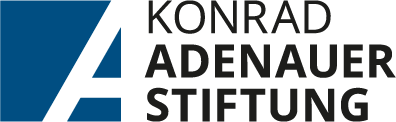Partizipation und Lebendigkeit
OECD-Lernkompass 2030 und Partizipation: Der OECD Lernkompass 2030 betont die Bedeutung von Partizipation als zentrale Kompetenz für eine nachhaltige Zukunft.

Worum geht es in Modul 1?
Partizipation und Lebendigkeit
Der OECD-Lernkompass 2030 und die Partizipation
Kurze Einleitung zum OECD Lernkompass 2030
Der OECD Lernkompass 2030 ist ein internationales Bildungsrahmenwerk, das darauf abzielt, Lernende auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorzubereiten. Angesichts des raschen technologischen und gesellschaftlichen Wandels betont der Lernkompass eine ganzheitliche Bildung, die weit über rein kognitive Kompetenzen hinausgeht. Im Mittelpunkt steht das Konzept der Transformative Competencies, die es Individuen ermöglichen, nachhaltige Werte zu schaffen, Spannungen zu bewältigen und Verantwortung zu übernehmen.
Der OECD Lernkompass 2030 betont die Bedeutung von Partizipation als zentrale Kompetenz für eine nachhaltige Zukunft. Lernende sollen befähigt werden, aktiv an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Partizipation umfasst Mitbestimmung, Kooperation und kritisches Denken, um positive Veränderungen zu bewirken. Schulen und Bildungssysteme sollten Räume schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Stimme einbringen und demokratische Prinzipien erleben können. Durch eine stärkere Beteiligung an Entscheidungsprozessen werden junge Menschen auf eine aktive Bürgerrolle in der Gesellschaft vorbereitet.
Durch diesen umfassenden Bildungsansatz trägt der OECD Lernkompass 2030 dazu bei, ein tiefgreifendes Verständnis für eine nachhaltige und inklusive Gesellschaft zu entwickeln.
Literaturverweise: OECD (2020). "OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes." OECD Publishing. Schleicher, A. (2018). "World Class: How to Build a 21st-Century School System." OECD Publishing. Hart, R. (1992). Children's Participation: From Tokenism to Citizenship. Florence: UNICEF Inn. Res. Ctr.
Eine partizipative Methode: Das ABC-Brainstorming
Die ABC-Brainstorming-Methode ist eine kreative Technik zur Ideensammlung, bei der Lernende Begriffe zu einem Thema in alphabetischer Reihenfolge notieren. Sie eignet sich besonders für aktivierende und strukturierende Unterrichtsphasen.
Die Methode ist flexibel und fördert Kreativität, Strukturierung und kollaboratives Arbeiten. Sie kann digital (z. B. mit einem kollaborativen Dokument) oder analog (z. B. auf Zettel und Plakaten) umgesetzt werden.
Fünf Anwendungsideen der ABC-Brainstorming-Methode
1. Wortschatzarbeit im Sprachunterricht
Anwendung: Lernende sammeln Wörter zu einem bestimmten Thema (z. B. „Umwelt“ im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht).
Praxistipp: Als Einzel- oder Gruppenarbeit durchführen und Ergebnisse anschließend diskutieren.
2. Einstieg in ein neues Thema
Anwendung: Vorwissen aktivieren, indem Schüler Begriffe zu einem neuen Thema (z. B. „Französische Revolution“) sammeln.
Praxistipp: Anschließend können die Begriffe in Kategorien geordnet oder durch eine Mindmap ergänzt werden.
3. Zusammenfassung und Reflexion
Anwendung: Am Ende einer Unterrichtseinheit notieren die Schüler Begriffe, die sie mit dem Thema verbinden.
Praxistipp: Jeder Schüler nennt einen Begriff, und die Klasse ergänzt fehlende Buchstaben gemeinsam.
4. Ideensammlung für kreative Schreibanlässe
Anwendung: Wörter zu einem Thema (z. B. „Abenteuer“) sammeln, um eine Geschichte oder ein Gedicht zu schreiben.
Praxistipp: Schüler wählen fünf Begriffe aus der Liste und integrieren sie in ihren Text.
5. Fachübergreifende Projektplanung
Anwendung: Begriffe für ein Projektthema (z. B. „Nachhaltigkeit“) sammeln und als Grundlage für die Recherche nutzen.
Praxistipp: Begriffe in Gruppen aufteilen und vertiefend bearbeiten lassen.
Begleitende Literatur- und Quellenhinweise Birkenbihl, Vera F.: ABC-Kreativ. Techniken zur kreativen Problemlösung. 5. Auflage Ariston-Verlag (2012) Philipp, J.: Brainstorming mal anders: Die ABC-Liste. Ruhr Universität Bochum 2023 (Webseite) Politische Bildung Bayern: Die ABC Methode. (PDF)
Übung: Darstellung der Demokratie
Darstellung der Demokratie-Übung (15 Minuten)
Diese Übung hilft dabei, das Thema Demokratie umfassend zu beleuchten und sich bewusst zu machen, welche unterschiedlichen Aspekte eine Rolle spielen.
Vorbereitung (3 Minuten)
1. Materialien bereitstellen:
- Zwei DIN A4-Blätter
- Einen Stift
2. Blätter in Zettel unterteilen:
- Jedes Blatt in 13 gleich große Zettel schneiden oder falten.
- Jeden Zettel mit einem Buchstaben von A bis Z beschriften.
Thema festlegen (1 Minute)
Das Thema dieser Übung ist Demokratie.
Ziel: Eine breite Sammlung von Begriffen und Assoziationen zu diesem Thema.
Wort-/Begriffssammlung (5 Minuten)
- Setze dir ein Zeitlimit von 5 Minuten, um den Prozess dynamisch zu halten.
- Schreibe zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff, ein Wort oder einen Aspekt zum Thema Demokratie auf den jeweiligen Zettel.
Beispiele:
- A für „Aushandeln“
- B für „Bürger“
- C für „Checks and Balances“
Tipp: Schreibe alles auf, was dir in den Sinn kommt, auch wenn es im ersten Moment nicht direkt passend erscheint.
Reflexion der Begriffe (3 Minuten)
Schau dir deine Begriffe an und überlege:
- Wie passt jeder Begriff zum Thema Demokratie?
- Gibt es Begriffe, die eine besonders zentrale Rolle spielen?
- Welche Begriffe sind weniger offensichtlich, aber dennoch wichtig?
- Falls du in einer Gruppe arbeitest, tauscht euch über eure Begriffe aus.
Begriffe sortieren und clustern (3 Minuten)
1. Kategorien identifizieren: Überlege, welche Schwerpunkte oder Kategorien sich aus deinen Begriffen ableiten lassen, z. B.:
- Politische Institutionen (z. B. Parlament, Wahlen)
- Bürgerrechte (z. B. Meinungsfreiheit, Gleichheit)
- Prozesse und Prinzipien (z. B. Partizipation, Gewaltenteilung)
2. Zettel nach Kategorien anordnen: Lege zusammengehörige Begriffe in Gruppen und analysiere deren Zusammenhänge.
Abschlussdiskussion (optional, 2-5 Minuten)
- Falls du die Übung in einer Gruppe machst, besprecht eure Kategorien.
- Welche Begriffe sind besonders häufig aufgetaucht?
- Gibt es Begriffe, die kontrovers diskutiert werden?
- Welche Erkenntnisse lassen sich aus dieser Übung für das Verständnis von Demokratie ableiten?
Reflexion: Wo ist Partizipation in deiner Schule sichtbar?
Nimm dir zum Abschluss dieses Moduls 10 bis 15 Minuten Zeit, um über Partizipation an deiner Schule zu reflektieren. Es gibt zahlreiche Ansätze und Übungen, um die Mitgestaltung im schulischen Alltag zu ermöglichen.
Welche erlebst du an deiner Schule?
Hier ein paar Beispiele zum Einstieg:
- Was sind zentrale Bereiche der Mitwirkung an deiner Schule? Ein zentraler Bereich ist die Mitwirkung in Gremien wie der Schülervertretung (SV). Hier können Schülerinnen und Schüler Anliegen einbringen, Veranstaltungen organisieren und Einfluss auf schulische Entscheidungen nehmen. Klassenratssitzungen sind eine weitere Möglichkeit, bei der Klassen gemeinsam über Regeln, Projekte und Konflikte diskutieren.
- Was können praxisnahe Methoden wie projektorientierte Lernen, um Partizipation zu fördern? Die Schülerinnen und Schüler wählen Themen, die sie interessieren und erarbeiten in Teams Lösungsansätze. Dies stärkt Teamarbeit und Eigenverantwortung.
- Warum ist eine Feedbackkultur essenziell? Regelmäßige Befragungen zu Unterrichtsqualität oder Schulklima geben den Lernenden eine Stimme. Ergänzend können Partizipationsübungen wie Rollenspiele oder Debatten im Unterricht genutzt werden, um demokratische Prozesse zu simulieren.
- Was bedeutet das Engagement in Vereinen? Schülerinnen und Schüler können aktiv in Sportvereinen, Musikvereinen oder Jugendgruppen mitwirken. Sie übernehmen dabei oft Verantwortung, z. B. als Mannschaftskapitän, Übungsleiter oder in der Organisation von Veranstaltungen. Dieses Engagement fördert Teamarbeit, Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein.
- Wie wirkt sich die Beteiligung in Gemeinden aus? In vielen Gemeinden gibt es Jugendparlamente oder Jugendbeiräte, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Anliegen und Ideen einbringen können. Sie können so an kommunalen Entscheidungen mitwirken, beispielsweise bei der Planung von Freizeitangeboten, Umweltprojekten oder der Gestaltung öffentlicher Plätze.
- Partizipation als soziale Arbeit in der Altenpflege? Im Rahmen von sozialen Projekten oder Freiwilligendiensten können Schülerinnen und Schüler in Altenpflegeheimen helfen. Sie lesen Bewohnern vor, führen Gespräche oder organisieren Freizeitaktivitäten. Dies stärkt nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern fördert auch das Verständnis für andere Generationen.
Partizipation erfordert grundsätzlich eine wertschätzende Haltung der Lehrkräfte und eine offene Kommunikation. So lernen Schülerinnen und Schüler, Verantwortung zu übernehmen und ihre Meinung konstruktiv zu äußern.