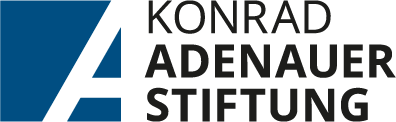Für viele Schüler und Schülerinnen fühlt sich der Schulalltag oft genau so an: Vorgaben statt Mitgestaltung, Frontalunterricht statt Mitsprache. Dabei ist Schule nicht nur ein Ort des Wissens, sondern sollte auch ein Ort gelebter Demokratie sein. Wenn Jugendliche mitentscheiden dürfen, ob der Pausenhof mehr Sitzgelegenheiten braucht, welche Themen sie im Projektunterricht bearbeiten oder wann Klassenarbeiten geschrieben werden, dann ist das kein „Extra“. Es ist ein demokratischer Lernmoment. Studien zeigen: Wo echte Mitbestimmung möglich ist, steigen nicht nur die Motivation und die Identifikation mit der Schule, sondern auch die Bereitschaft, sich später aktiv in Gesellschaft und Politik einzubringen (Quenzel, Beck & Jungkunz, 2023).
Warum Mitbestimmung mehr ist als ein Klassenrat
Partizipation ist ein zentrales Element der Demokratiebildung. Es reicht nicht aus, Demokratie als Faktenwissen im Unterricht zu vermitteln – sie muss erlebbar sein. Frühzeitige Beteiligung stärkt Selbstwirksamkeit, Verantwortungsgefühl und soziale Kompetenzen. Schulen sollten daher nicht nur Wissen vermitteln, sondern Räume schaffen, in denen Jugendliche sich als aktive Gestalter:innen ihrer Lebenswelt erfahren. Beteiligungsformate fördern Schlüsselkompetenzen wie Empathie, Dialogfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Kritikfähigkeit – unerlässlich im 21. Jahrhundert (Quenzel, Beck & Jungkunz, 2023). Entscheidend ist: Mitbestimmung darf keine symbolische Geste sein, sondern muss strukturell in schulische Prozesse eingebunden sein.
Mitbestimmung wirkt über die Schule hinaus
Mitgestaltung endet nicht im Klassenzimmer. Es braucht gesamtgesellschaftlich Räume, in denen junge Menschen gehört und ernst genommen werden. Ein Beispiel ist das Projekt Generation BD des Forums Bildung Digitalisierung und der Deutschen Telekom Stiftung. Jugendliche ab Klasse 10 aus unterschiedlichen Bundesländern und Schulformen entwickelten darin konkrete Empfehlungen, wie Schule zukunftsfähig gestaltet werden kann – zu Themen wie Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, mentaler Gesundheit und Partizipation. Das zeigt: Junge Perspektiven bereichern den Diskurs – wenn man ihnen Raum gibt.
So gelingt Mitbestimmung
Verschiedene Projekte zeigen, wie Mitbestimmung praktisch unterstützt werden kann – etwa durch Online-Plattformen zur politischen Beteiligung oder durch lokale Beteiligungsprojekte. Auch methodisch gibt es Ansatzpunkte: Diskussionsformate helfen Schüler und Schülerinnen, eigene Positionen zu formulieren. Und Methoden der Futures Literacy stärken das Verständnis dafür, wie heutige Entscheidungen zu wünschenswerten Zukünften führen können.
Demokratie beginnt im Kleinen – und wirkt nach außen
Schule muss ein Ort der Auseinandersetzung mit realen gesellschaftlichen Herausforderungen sein – von Klimakrise über soziale Gerechtigkeit bis Krieg. UNESCO (2015, 2021) und OECD (2018) betonen: Beteiligung in der Schule ist der erste Schritt zu globalem Engagement. Wer im Klassenrat diskutiert, traut sich später auch ins Stadtparlament. Wer Verantwortung bei der Pausenhofgestaltung übernimmt, versteht auch globale Nachhaltigkeit besser: Global Citizenship beginnt nicht mit einem Auslandseinsatz oder großen Weltzielen, sondern mit kleinen Entscheidungen im Klassenzimmer – dort, wo junge Menschen Verantwortung übernehmen und lernen, dass ihre Haltung zählt.
Was muss sich ändern, damit Mitbestimmung gelingt?
Trotz der Potenziale sieht die Realität oft anders aus: Nur etwa ein Drittel der Schüler und Schülerinnen fühlt sich in Entscheidungen einbezogen (Andresen & Möller, 2019). Woran liegt das?
- Machtungleichgewichte: Erwachsene entscheiden häufig für statt mit den Jugendlichen. Es braucht eine Haltung, die junge Menschen als entscheidungsfähig anerkennt.
- Fehlende Verbindlichkeit: Beteiligung ist oft symbolisch. Nur wer strukturelle Mitbestimmung im Schulalltag verankert, schafft echte Teilhabe.
- Unsicherheit bei Lehrkräften: Vielen fehlen klare Strukturen und Fortbildungen. Hier braucht es gezielte Qualifizierung, um partizipative Prozesse professionell zu begleiten.
Demokratie erlebbar machen – unser Beitrag auf adenauercampus.de
Mitbestimmung in der Schule ist kein „Nice-to-have“, sondern ein zentraler Baustein zeitgemäßer Bildung. Sie stärkt demokratische Kompetenzen, Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl – und zeigt jungen Menschen: Deine Stimme zählt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt diesen Wandel mit innovativen Materialien, digitalen Lernformaten und Projekten wie der Demokratie Starterbox auf adenauercampus.de. Unser Ziel ist es, Demokratie im Schulalltag erlebbar zu machen – dort, wo sie beginnt: im Kleinen, im Klassenzimmer, im konkreten Mitgestalten.
Quellen:
Andresen, S., & Möller, R. (unter Mitarbeit von Wilmes, J., Cinar, D., & Nolting, P.). (2019). Children’s Worlds+: Eine Studie zu Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Gesamtauswertung. Bertelsmann Stiftung.
OECD. (2018). Preparing our Youth for an Inclusive and Sustainable World: The OECD PISA Global Competence Framework. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
UNESCO. (2015). Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993
UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://doi.org/10.54675/ASRB4722
Quenzel, G., Beck, M., & Jungkunz, S. (Hrsg.). (2023). Bildung und Partizipation: Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Verlag Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84742614