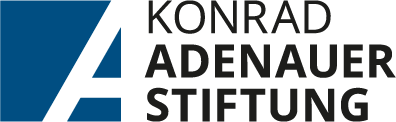Demokratie vs. Autokratie
Kritierien für Demokratie - welche Quellen können wir nutzen?
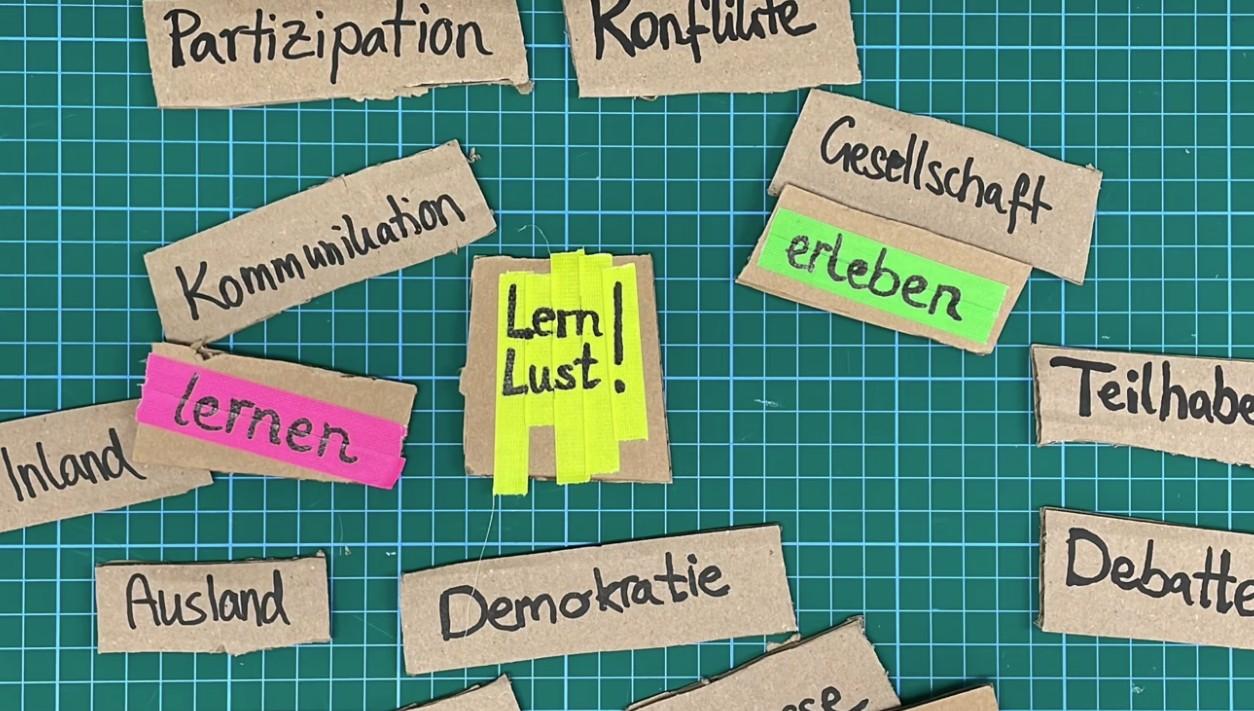
Worum geht es in Modul 6?
Kriterien für Demokratie - Welche Quellen können wir nutzen?
Um die Kriterien einer Demokratie fundiert zu erarbeiten, können verschiedene Quellen herangezogen werden. Hier sind einige der wichtigsten Kategorien und Beispiele.
1. Wissenschaftliche Literatur
- Standardwerke zur Demokratietheorie: Bücher und Aufsätze von Politikwissenschaftlern wie Robert A. Dahl (Polyarchy), Jürgen Habermas (Theorie des kommunikativen Handelns), oder Giovanni Sartori (The Theory of Democracy Revisited).
- Lehrbücher der Politikwissenschaft: Diese bieten oft eine systematische Einführung in die Merkmale und Typen von Demokratien, z. B. Demokratie: Theorien und Probleme von Wolfgang Merkel.
- Artikel in Fachzeitschriften: Publikationen wie Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, Democratization, oder Journal of Democracy.
2. Internationale Organisationen
- Venedig-Kommission des Europarates: Leitlinien für demokratische Wahlen und Rechtsstaatlichkeit.
- Freedom House: Berichte zur politischen Freiheit und Bürgerrechten weltweit (z. B. Freedom in the World Report).
- UNDP (United Nations Development Programme): Berichte zur Demokratisierung und zur Förderung von Good Governance.
- OECD-Dokumente: Insbesondere zu partizipativer Demokratie und institutionellen Rahmenbedingungen.
3. Nationale und internationale Rechtsgrundlagen
- Verfassungen: Verfassungen demokratischer Staaten, z. B. das deutsche Grundgesetz (insbesondere Artikel 1–20).
- Internationale Verträge: Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) oder die UN-Charta.
- Rechtsprechung: Urteile von Verfassungsgerichten und internationalen Gerichtshöfen, die die demokratischen Prinzipien konkretisieren.
4. Indizes und Messinstrumente
- Democracy Index (The Economist Intelligence Unit): Bewertet die Demokratie weltweit auf Basis von Kriterien wie Wahlen, Pluralismus und Bürgerrechten.
- Varieties of Democracy (V-Dem): Differenziertes Instrument zur Messung demokratischer Qualität.
- Polity IV: Ein Index, der Staaten nach ihrem demokratischen Charakter einstuft.
5. Historische und empirische Quellen
- Historische Beispiele: Analysen demokratischer Transformationen (z. B. die Demokratisierung nach 1945 in Deutschland oder die postkommunistischen Demokratien in Osteuropa).
- Empirische Studien: Datenbanken wie World Values Survey oder Eurobarometer, die Einstellungen zu Demokratie untersuchen.
6. NGOs und Think-Tanks
- Transparency International: Analysen zu Korruption und deren Auswirkungen auf Demokratien.
- Bertelsmann Stiftung (BTI): Transformation Index mit Kriterien zu Demokratie und Governance.
- Politische Stiftungen, z.B. die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Auslandbüros
- Carnegie Endowment for International Peace: Forschung zu globalen Demokratietrends.
7. Bildung und Öffentlichkeit
- Schulbücher und populärwissenschaftliche Werke: Materialien für die allgemeine politische Bildung.
- Medien und Journalismus: Qualitativ hochwertige Analysen und Berichte über die Funktionsweise von Demokratien, z. B. durch renommierte Zeitungen wie Die Zeit in Deutschland, The Guardian Großbritannien oder New York Times in den USA.
Ein konkretes Beispiel aus dem Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung Marokko: Bürgerrechte, Pluralismus und freie Wahlen
BÜRGERRECHTE
Wie wird das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung gewährleistet?
Sind alle Bürger unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Religion oder sexueller Orientierung vor dem Gesetz gleich? Gibt es institutionelle Maßnahmen gegen Diskriminierung?
In Mauretanien sind alle Bürgerinnen und Bürger laut Verfassung formal vor dem Gesetz gleich, unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Religion. Dennoch gibt es in der Praxis erhebliche Unterschiede zwischen dem verfassungsmäßigen Anspruch und der Realität. Die gesellschaftlichen und rechtlichen Strukturen des Landes sind stark von traditionellen, patriarchalen und religiösen Normen geprägt, die Diskriminierung begünstigen.
Mauretanien ist ethnisch vielfältig, mit arabischen Mauretaniern (Beydan), afro-mauretanischen Gemeinschaften sowie Haratin (ehemaligen Sklaven). Insbesondere Haratin und afro-mauretanische Gruppen erleben systematische Diskriminierung und soziale Marginalisierung. Sklaverei, obwohl offiziell abgeschafft, besteht weiterhin in Form von Abhängigkeitsverhältnissen und wird oft nicht strafrechtlich verfolgt.
Mauretanien ist eine islamische Republik, und der Islam ist Staatsreligion. Religiöse Minderheiten, wie Christen oder Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen, können ihren Glauben privat ausüben, werden aber in der Öffentlichkeit oft eingeschränkt. Der Abfall vom Islam (Apostasie) wird rechtlich streng bestraft, sogar mit der Todesstrafe, was nicht-muslimische Gruppen faktisch unsichtbar macht.
Frauen sind zwar laut Verfassung gleichberechtigt, doch patriarchale Traditionen und islamisches Recht (Scharia) schränken diese Gleichheit ein. Beispielsweise haben Frauen im Erbrecht oft geringere Ansprüche als Männer, und in Fällen von Vergewaltigung müssen Frauen unter Umständen Beweise vorlegen, um nicht selbst wegen außerehelichen Verhältnissen angeklagt zu werden. Frauen sind in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert, obwohl es Quotenregelungen gibt, um ihre Beteiligung zu erhöhen.
Homosexualität ist in Mauretanien verboten und wird streng bestraft, einschließlich der Todesstrafe für Männer. Die gesellschaftliche Ablehnung von LGBTQ+-Personen ist weit verbreitet, und es gibt keinen rechtlichen Schutz gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.
Die mauretanischen Behörden haben in den letzten Jahren mehrere Gesetze gegen Diskriminierung erlassen, einschließlich solcher, die Sklaverei verbieten. Die Regierung hat außerdem Gerichte und Institutionen geschaffen, um Sklaverei zu bekämpfen, wie die
„Agentur zur Bekämpfung der Überreste von Sklaverei“. Doch deren Wirksamkeit ist begrenzt, da soziale Normen die Umsetzung erschweren. Während die Verfassung in Mauretanien die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger garantiert, bleibt Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Religion und sexueller Orientierung ein großes Problem. Institutionelle Maßnahmen existieren, sind jedoch oft ineffektiv, da tief verwurzelte soziale und kulturelle Normen Veränderungen behindern.
PLURALISMUS
Wie vielfältig ist das politische System des Landes und wie stark werden Minderheitenmeinungen in Entscheidungsprozesse eingebunden?
Das politische System Mauretaniens ist formal ein Mehrparteiensystem in einer Präsidialrepublik, in der der Präsident erhebliche Machtbefugnisse besitzt. Trotz einer gewissen politischen Vielfalt durch die Existenz zahlreicher Parteien und zivilgesellschaftlicher Akteure wird die tatsächliche Einbindung von Minderheitenmeinungen und die demokratische Teilhabe durch verschiedene strukturelle und soziale Faktoren eingeschränkt.
In Mauretanien sind offiziell dutzende politische Parteien registriert. Diese Parteien reichen von islamistisch-konservativen Gruppierungen bis hin zu sozialistischen und liberalen Parteien. Die politische Vielfalt ist jedoch eingeschränkt, da viele Parteien ethnisch oder regional geprägt sind. Zudem wird die politische Szene von der regierenden Elitenklasse dominiert, oft mit engen Verbindungen zum Militär und zur arabischen Mauretanier-Mehrheit (Beydan). Afro-mauretanische und Haratin-Minderheiten haben geringeren Zugang zu politischen Machtpositionen. Minderheiten wie die Haratin (Nachkommen von Sklaven) und afro-mauretanische Gemeinschaften sind formell politisch gleichgestellt, stehen jedoch in der Praxis vor erheblichen Barrieren. Die politischen Strukturen begünstigen die arabisch-mauretanische Elite, während Minderheiten oft von wichtigen Machtpositionen ausgeschlossen sind. Initiativen und Parteien, die sich gezielt für Minderheitenrechte einsetzen, stoßen häufig auf Widerstand oder werden politisch marginalisiert.
Zivilgesellschaftliche Organisationen spielen eine zunehmend wichtige Rolle, um die Stimmen von Minderheiten zu artikulieren. Organisationen, die sich gegen Sklaverei und für soziale Gerechtigkeit einsetzen, haben nationale und internationale Aufmerksamkeit gewonnen. Trotz ihrer Bemühungen werden sie allerdings oft durch staatliche Repression oder bürokratische Hindernisse eingeschränkt.
Die Medien in Mauretanien bieten nur einen begrenzten Raum für die Meinungsäußerung von Minderheiten. Während es einige unabhängige Medien gibt, die sich kritisch mit Diskriminierung und sozialen Ungleichheiten befassen, sind viele Medien staatlich kontrolliert oder von der arabischen Mehrheitskultur dominiert. Das erschwert es Minderheiten, ihre Anliegen in der breiten Öffentlichkeit zu vertreten. Solange jedoch ethnische und soziale Ungleichheiten bestehen und der politische Einfluss durch die arabisch-mauretanische Elite dominiert wird, bleibt die Integration von Minderheitenmeinungen begrenzt.
FREIEN WAHLEN
Besteht Chancengleichheit für alle politischen Parteien?
Haben alle Parteien und Kandidaten Zugang zu Ressourcen wie Medienpräsenz,
Wahlkampffinanzen und dem öffentlichen Raum?
In Mauretanien ist das politische System formal ein Mehrparteiensystem, das allen registrierten Parteien und Kandidaten die Teilnahme an Wahlen ermöglicht. In der Praxis gibt es jedoch erhebliche Unterschiede im Zugang zu Ressourcen wie Medienpräsenz, Wahlkampffinanzierung und öffentlichem Raum, die sich auf die Chancengleichheit auswirken.
Der Zugang zu Medien ist für politische Akteure in Mauretanien ungleich verteilt. Die staatlichen Medien dominieren die Informationslandschaft und stehen in der Regel der regierenden Partei oder der politischen Elite näher. Oppositionelle Stimmen und kleinere Parteien haben oft Schwierigkeiten, ihre Botschaften in diesen Kanälen zu verbreiten. Es gibt zwar unabhängige Medien und eine wachsende Nutzung sozialer Medien, die eine Plattform für oppositionelle Parteien und Kandidaten bieten. Dennoch ist die Reichweite dieser Kanäle begrenzt, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo viele Bürgerinnen und Bürger auf staatliche Medien angewiesen sind.
Die Finanzierung von Wahlkämpfen ist ein zentraler Aspekt der politischen Chancengleichheit, doch es gibt hierbei erhebliche Ungleichheiten. So gibt es eine begrenzte staatliche Finanzierung für registrierte Parteien, die sich an Wahlen beteiligen. Diese Mittel sind jedoch oft unzureichend, um kleinere Parteien oder unabhängige Kandidaten effektiv zu unterstützen. Größere Parteien, insbesondere die regierende Elite, profitieren hingegen von erheblichen privaten Finanzquellen, oft durch enge Verbindungen zu wohlhabenden Unterstützern oder der Geschäftswelt. Diese finanziellen Ressourcen verschaffen ihnen einen erheblichen Vorteil gegenüber der Opposition. Für die Herkunft und den Einsatz von Wahlkampfgeldern gibt es zudem kaum wirksame Kontrollmechanismen. Dies führt letztlich zu einem ungleichen Wettbewerb, bei dem finanzstärkere Parteien dominieren.
Auch der Zugang zu öffentlichen Räumen für Wahlveranstaltungen ist ungleich verteilt. Die regierende Partei hat oft leichteren Zugang zu öffentlichen Plätzen und Einrichtungen für ihre Wahlkampagnen. Oppositionsparteien und unabhängige Kandidaten berichten hingegen über bürokratische Hürden oder direkte Verbote bei der Nutzung öffentlicher Räume. Dies schränkt ihre Fähigkeit erheblich ein, mit Wählern in Kontakt zu treten. Diese Ungleichheiten beeinträchtigen die politische Chancengleichheit erheblich und stellen eine Herausforderung für die demokratische Entwicklung des Landes dar.
F. TRIVIA INFOS
Mauretanien
1. In Mauretanien verkehrt der mit 2,5 Kilometern viertlängste Güterzug der Welt und transportiert Eisen von den Minen in Zouérat zur Hafenstadt Nouadhibou.
2. Mauretanien gehört zu den trockensten Ländern der Welt, viele Gebiete bekommen jahrelang keinen Regen.
3. In der Wüste von Mauretanien gibt es noch traditionelle Karawanen, die Salzblöcke transportieren.
4. Die Richat-Struktur, auch "Auge der Sahara" genannt, ist ein riesiges geologisches Phänomen, das aus dem Weltall sichtbar ist.
Demokratie vs. Autokratie - Wo finden wir die Demokratie?
Beschreibung Playbox
Lernziele
- Die Schülerinnen & Schüler sollen Verständnis für die Unterschiede zwischen Demokratie und Autokratie entwickeln.
- Sie sollen die Verhältnisse der politischen Systeme auf der Welt erkennen und reflektieren.
- Die Schülerinnen & Schüler lernen, Begriffe zu den politischen Systemen einzuordnen und ihre Bedeutung zu diskutieren.
1. Hook: Musik-Impuls
Die Schülerinnen und Schüler betreten den Raum, während verschiedene Nationalhymnen gespielt werden, die sowohl demokratische als auch autokratische Systeme repräsentieren. Dies soll die Aufmerksamkeit wecken und die Schüler*innen auf das Thema einstimmen.
2. Warm-up: Schlagwort-Zuordnung
Auf dem Boden liegen Schlagwörter verteilt, die die Schülerinnen und Schüler den politischen Systemen Demokratie oder Autokratie zuordnen sollen. Die Schlagwörter werden in zwei Rechtecke, die auf den Boden mit Tape markiert sind (neongelb: Demokratie und neonrosa: Autokratie) gelegt.
Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei Gruppen geteilt, die jeweils für Demokratie oder Autokratie stehen. Sie stellen sich gegenüber und lesen sich die Schlagwörter gegenseitig vor, um die Begriffe zuzuordnen.
3. Erarbeitung: Politische Systeme der Kontinente
Die Schülerinnen und Schüler werden in fünf Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen Kontinent bearbeiten (Europa, Asien/Australien, Afrika, Nord- und Mittelamerika, Südamerika).
Die Gruppen erhalten Poster der Kontinente und untersuchen, welche politischen Systeme in den jeweiligen Ländern vorhanden sind. Die Länder werden je nach System entweder mit neongelber (Demokratie) oder neonrosaner (Autokratie) Farbe markiert.
Die Schlagwörter können zur Unterstützung genutzt werden, um die Unterschiede zwischen den Systemen herauszuarbeiten. Zusätzlich können unterschiedliche Quellen zur Verfügung gestellt werden.
4. Anwendung und Vertiefung: Weltbetrachtung und Diskussion
Die Klasse betrachtet gemeinsam die Länder der verschiedenen Kontinente.
Reflexionsfragen: Was fällt euch auf? Wie ist das Verhältnis zwischen Demokratie und Autokratie? Welche Weltordnung erkennt ihr? Was überrascht euch?
Die Lehrkraft moderiert die Diskussion über die Unterschiede zwischen den politischen Systemen.
5. Reflexion und Feedback: Austausch in der Klasse
Die Schülerinnen und Schüler geben einander konstruktives Feedback zur Arbeit in den Gruppen und zur Diskussion.
Diskussion über die Herausforderungen der politischen Systeme und wie diese Erkenntnisse auf aktuelle politische Diskussionen angewendet werden können.
Erweiterte Frage: Welche Elemente der politischen Systeme könnten auch in anderen Kontexten nützlich sein?
Timeboxing:
1. Hook - bis alle Schülerinnen und Schüler den Klassenraum betreten haben
2. Warm-up - 10 Minuten
3. Erarbeitung - 30 Minuten
4. Anwendung und Vertiefung - 30 Minuten
5. Reflexion und Feedback - 20 Minuten