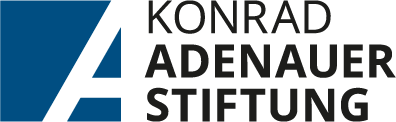Meinungsfreiheit – Euer Recht, eure Verantwortung online
Was darf ich sagen? Was lieber nicht? Im Netz scheinen die Regeln oft verschwommen zu sein. Jeder postet schnell eine Meinung, aber nicht alles, was man denkt, darf man auch ungefiltert teilen. Dieses Modul hilft euch zu erkennen, wo die Freiheit der Worte endet und wo der Schutz anderer beginnt. Eure Stimme ist stark, aber nutzt sie klug!

Was ist eigentlich Meinungsfreiheit online? Schaut euch das Video an und lernt Ben kennen!
Meinungsfreiheit in einer Demokratie – Warum ist das so wichtig?
Ihr habt das Recht, eure Meinung frei zu äußern, zu schreiben und zu verbreiten, ohne Angst vor staatlicher Zensur oder Bestrafung haben zu müssen. Die Meinungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte in unserer Demokratie. Dieses Recht ist nicht einfach nur eine Idee, sondern fest im Artikel 5 unseres Grundgesetzes verankert:
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten."
Eine Gesellschaft, in der Meinungen offen ausgetauscht und diskutiert werden dürfen, ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Nur so können sich Bürgerinnen und Bürger informieren, Positionen bilden und an politischen Prozessen teilnehmen. Und nur so sind eine Vielfalt von Ideen und Perspektiven möglich, die uns helfen, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um Lösungen und neue Ansätze für die Zukunft zu finden. Denn Meinungsfreiheit erlaubt es, Missstände zu kritisieren, Regierungshandeln zu hinterfragen und für Veränderungen einzutreten.
Was heißt das online? – Die Herausforderungen der digitalen Welt
Das Internet ist wie ein Megaphon, denn online haben eure Worte und Bilder eine viel größere Reichweite als in der realen Welt. Diese große Chance zur freien Meinungsäußerung birgt aber auch einige Risiken. Denn die (vermeintliche) Anonymität im Netz kann die Hemmschwelle senken, so dass Meinungen oft impulsiver und extremer geäußert werden als im persönlichen Gespräch.
Auch vermischen sich im Netz oft Meinungen mit „angeblichen“ Fakten. Das erschwert die Unterscheidung, was eine persönliche Ansicht und was eine belegbare Tatsache ist. Hier spielen Fake News, Verschwörungstheorien und Propaganda eine große Rolle, die sich online rasend schnell verbreiten können und die öffentliche Meinung manipulieren wollen.
Euch muss ebenfalls bewusst sein, dass geäußerte Meinungen im Netz Konsequenzen haben können. Shitstorms sind beispielsweise eine Form davon, die zur sozialen Ablehnung führen können, weil die Öffentlichkeit oder Gesellschaft darauf reagiert. Ein verwandtes Phänomen ist die „Cancel Culture“, bei der Personen aufgrund kontroverser oder als anstößig empfundener Äußerungen – auch aus der Vergangenheit – von der Öffentlichkeit oder bestimmten Gruppen gemieden oder boykottiert werden.
Wichtig ist auch, dass Soziale Medien wie Instagram, TikTok oder YouTube zusätzlich zu den Gesetzen auch eigene Nutzungsbedingungen und Community Guidelines haben. Wenn ihr diese verletzt, können Inhalte gelöscht oder Accounts gesperrt werden. Dies fällt unter das "Hausrecht" der Plattformen und stellt keine Einschränkung eurer staatlich garantierten Meinungsfreiheit dar. Zudem gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das große soziale Netzwerke dazu verpflichtet, strafbare Inhalte (z.B. Beleidigungen, Volksverhetzung) nach Meldung schnell zu löschen.
Tipp
Nutzt die Meldefunktion! In fast allen sozialen Netzwerken könnt ihr rechtswidrige Inhalte direkt melden.

Wozu ist das gut?
Das Grundgesetz schützt euch davor, dass der Staat euch für eure Meinung nicht bestraft, solange ihr die Grenzen nicht überschreitet. Richtig, unsere Meinungsfreiheit ist nicht grenzenlos. Denn der Artikel 5 des Grundgesetzes hat einen wichtigen Zusatz:
"[...] Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre."
Das bedeutet, dass eure Meinungsfreiheit dort endet, wo die Rechte und der Schutz anderer beginnen. Das betrifft vor allem:
-
Beleidigung und Verleumdung: Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder anderer Merkmale öffentlich angegriffen oder zur Zielscheibe von Hass oder Hetze gemacht werden.
-
Hassrede und Diskriminierung: Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder anderer Merkmale öffentlich angegriffen oder zum Hass gegen ihn aufgerufen werden.
-
Jugendgefährdende Inhalte: Inhalte, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefährden (z.B. extrem gewalttätige oder pornografische Inhalte), sind ebenfalls tabu.
Wenn Kommentare/Posts zur Straftat werden
Meinungsfreiheit bedeutet nicht Narrenfreiheit. Es gibt klare rote Linien im Strafgesetzbuch (StGB).
-
Beleidigung (§ 185 StGB): Eine Beleidigung liegt vor, wenn ihr die Ehre einer anderen Person angreift und deren Achtung mindert. Das können Schimpfwörter, herabwürdigende Gesten sein, oder auch ein Kommentar wie "Idiot" oder "Versager". Selbst ein beleidigendes Bild oder Emoji kann darunterfallen.
-
Üble Nachrede (§ 186 StGB): Ihr schreibt in einem Chat, dass eine Mitschülerin bei der letzten Prüfung gespickt hat. Ihr habt das nur gehört und könnt es nicht beweisen. Wenn ihr so etwas weiterverbreitet und die Person dadurch schlecht dasteht oder ihr Ruf geschädigt wird, dann ist das Üble Nachrede.
-
Verleumdung (§ 187 StGB): Dies ist ähnlich wie die üble Nachrede, jedoch noch schwerwiegender. Hier verbreitet ihr absichtlich eine Unwahrheit über eine andere Person, um diese zu schädigen. Zum Beispiel, wenn ihr bewusst verbreitet, euer Lehrer nehme Bestechungsgelder an, um ihn in Misskredit zu bringen. Ihr wisst also genau, dass eure Behauptung falsch ist.
-
Volksverhetzung (§ 130 StGB): Ein Verstoß gegen diesen Paragrafen stellt eine besonders schwerwiegende Form der Rechtsverletzung dar. Es geht um Äußerungen, die zum Hass gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen aufstacheln, zu Gewalt oder Willkür gegen sie aufrufen oder die Menschenwürde dieser Gruppen angreifen. Dazu zählen beispielsweise die Verbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien, gezielte und böswillige Herabwürdigung oder das Leugnen von Völkermorden wie dem Holocaust. Wichtig ist: Hass, Herabsetzung oder bewusst falsche Behauptungen über andere sind niemals von der Meinungsfreiheit gedeckt und haben ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen.

Werturteil, Schmähkritik und Tatsachenbehauptung – feine, aber wichtige Unterschiede
Es ist manchmal gar nicht so leicht, zu erkennen, ob ein Satz eine bloße Ansicht, eine bösartige Abwertung oder sogar eine unwahre Behauptung ist. Diese Unterscheidung ist jedoch äußerst wichtig. Denn von ihr hängt ab, ob eure Worte noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind oder ob sie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
Um die Grenzen der Meinungsfreiheit besser beurteilen zu können, schauen wir uns die verschiedenen Arten genauer an.
-
Ein Werturteil ist eine persönliche Meinung, eine Stellungnahme, ein Urteil oder eine Bewertung. Es drückt aus, was ihr denkt, fühlt oder wie ihr etwas findet. Werturteile können nicht bewiesen oder widerlegt werden und sie genießen den vollen Schutz der Meinungsfreiheit, auch wenn sie kritisch, hart oder unpopulär sind.
Beispiele
"Ich finde das neue Schul-Mensa-Essen total eklig!“, "Dein Style ist geschmacklos.", "Diese Serie ist die beste, die ich je gesehen habe!"
-
Eine Tatsachenbehauptung ist eine Aussage über etwas, was geschehen ist oder existiert, und das objektiv beweisbar (wahr oder unwahr) ist. Tatsachenbehauptungen sind nur geschützt, wenn sie wahr sind. Sind es Unwahrheiten, die andere schädigen, bewegt ihr euch im Bereich der üblen Nachrede oder Verleumdung.
Beispiele
"Der Film hat 10 Millionen Euro eingespielt.", "Das Produkt enthält die schädliche Stoffe XY."
- Eine Schmähkritik ist eine besonders schwere Form der Beleidigung und nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt. Hier geht es nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung, sondern nur noch um die persönliche Herabwürdigung einer Person. Der Fokus liegt ausschließlich darauf, jemanden schlecht zu machen.
Beispiele
"Der Schulsprecher ist ein Arschloch, der nur lügt und manipuliert. Seine Position hat er nur durch seine Eltern bekommen!", "XY ist eine hässliche Bitch, die niemand sehen will!"
Der Fall Böhmermann verus Erdogan
Im Jahr 2016 trug Jan Böhmermann, ein deutscher Satiriker, in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ ein sehr kontroverses Gedicht („Schmähgedicht“) über den türkischen Präsidenten Erdoğan vor. Dies führte nicht nur zu einer Klage, sondern löste auch eine breite öffentliche Debatte darüber aus, wie weit Satire eigentlich gehen darf. Erdoğan klagte auf Basis eines speziellen Gesetzes, des Paragraphen 103 ("Majestätsbeleidigungs"-Paragraph) im Strafgesetzbuch, der die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter unter Strafe stellte.

Der Fall Böhmermann zeigte deutlich, wie umstritten die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit, Satire und Beleidigung sein können. Die öffentliche Debatte war so groß, dass der veraltete Paragraph 103 StGB („Majestätsbeleidigung“) im Jahr 2018 abgeschafft wurde. Auch wenn es diesen speziellen Paragraphen nicht mehr gibt, bleibt der Straftatbestand der Beleidigung (§ 185 StGB) weiterhin bestehen.
Schlussendlich stellte die Staatsanwaltschaft Mainz das strafrechtliche Verfahren gegen Jan Böhmermann ein, da sein Gedicht zwar als grenzüberschreitende Satire galt, aber keinen strafbaren Tatbestand erfüllte. Auch eine Beschwerde von Präsident Erdoğan gegen diese Entscheidung blieb erfolglos. Zivilrechtlich untersagte das Landgericht Hamburg Böhmermann jedoch, bestimmte Passagen des Gedichts zu wiederholen, da sie als unzulässige Schmähkritik eingestuft wurden.
Der Fall verdeutlicht, dass die Grenzen zwischen Satire, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten immer wieder neu ausgehandelt werden müssen und sich auch rechtlich weiterentwickeln können.